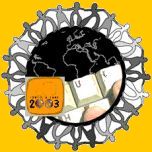Berichte
Solidarische Globalisierung: Das Weltsozialforum von Porto Alegre
sowie ein Interview mit João Pedro Stedile von der nationalen Leitung der MST
(von Gerhard Dilger, Informationsstelle Lateinamerika)
Porto Alegre - Ein zierlicher Mann mit schwarzem Schnauzbart und in dezentem Anzug bahnt sich
den Weg durch die bunte Menge von AktivistInnen aus aller Welt. Rote Fahnen
werden geschwenkt, "Olívio, Olívio"-Sprechchöre erschallen im
riesigen Auditorium der Katholischen Universität von Porto Alegre. Auf der
Abschlussveranstaltung des Weltsozialforums erhält kaum jemand mehr Beifall
als der Gastgeber: Olívio Dutra, 58, Gouverneur des Bundesstaates Rio
Grande do Sul.
Dutra
gehört zur Gründergeneration der brasilianischen Arbeiterpartei PT.
1988 wurde er in Porto Alegre als erster PT-Politiker zum Bürgermeister
einer Landeshauptstadt gewählt. Die Kassen waren leer, die Gegnerschaft des
einheimischen Establishments enorm. Also machte sich die kommunale PT-Spitze
daran, ihre "Isolation zu durchbrechen," so Luciano Brunet vom"Bürgerbüro der Beziehungen zur Gemeinschaft".
In Zusammenarbeit mit der Basisbewegung aus den Armenvierteln
entstand dasOrçamento Participativo (OP) - übersetzt: "Partizipative
Haushaltsaufstellung"-, das
inzwischen zum Markenzeichen von Porto Alegre und manch anderer PT-regierter
Stadt geworden ist.
Demokratie in den Gemeinden Wir
fingen an, den Mangel transparent zu verwalten", erzählt Brunet.
"Die Bevölkerung wurde nach Prioritäten gefragt, die wenigen Mittel
in den bedürftigten Stadtvierteln konzentriert." Nach diesen beiden
Prinzipien funktioniert das OP bis heute. Zunächst werden auf Bürgerversammlungen
in 16 Bezirken die örtlichen Prioritäten festgelegt. Soll eine
Kinderkrippe gebaut werden? Oder ist die Renovierung des Kulturzentrums
wichtiger? Oder vielleicht doch die Asphaltierung zweier Nebenstraßen?
Parallel dazu beraten Vertreter von Basisbewegungen auf fünf thematischen
Foren über die Struktur der Investitionen im Stadthaushalt - derzeit etwa
15 Prozent des gesamten Etats, denn der Löwenanteil besteht aus laufenden
Kosten wie den Gehältern der städtischen Angestellten.
Die
Bürger- und Delegiertenversammlungen erarbeiten bis Ende September konkrete
Investitionspläne, wobei die Exekutive nur den Umfang der bereitstehenden
Mittel bekannt gibt. Der Bürgermeister präsentiert die Vorschläge unverändert
dem Stadtparlament, das bis Ende November den Jahreshaushalt verabschiedet.
Im vergangenen Jahr waren rund 30.000 Menschen am OP für den Jahresetat
2001 beteiligt - von insgesamt 1,4 Millionen Einwohnern. Durch diese Form
der direkten Mitbestimmung sind Korruption und Vetternwirtschaft, ein Grundübel
brasilianischer Politik, in Porto Alegre so gut wie unbekannt.
Konservative
Kritiker beklagen, dass Mitglieder der Arbeiterpartei den gesamten Prozess
dominieren. Die PT verstoße gegen in der Verfassung vorgegebenen
Mechanismen der repräsentativen Demokratie, behauptet etwa der emeritierte
Politologe José Giusti Tavares. Für ihn ist das OP ein
"Machtinstrument der PT". Das Wahlvolk scheint es nicht zu stören:
Ende Oktober 2000 erzielte der jetzige Bürgermeister Tarso Genro, der
bereits von 1992 bis 1995 im Amt war, in der Stichwahl 63 Prozent aller
Stimmen.
Ein
konkretes Beispiel, wie sich die Bürgerbeteiligung auszahlen kann, ist der
Wohnkomplex Lupicínio Rodrigues im Zentrum Porto Alegres. Noch vor drei
Jahren befand sich an gleicher Stelle ein Armenviertel, eine "ziemlich
wilde Favela," wie Valdemar de Oliveira meint. Unter der Leitung des rührigen
Vorsitzenden der örtlichen Bürgervereinigung erstritten sich die 80
Familien auf den OP-Versammlungen ihres Bezirks die Haushaltsmittel für den
Neubau des Viertels. Während der Übergangszeit von einem knappen Jahr
wohnten sie in großen Schuppen.
Auch
heute stehen Oliveira mit seiner vierköpfigen Familie nur zwei Stockwerke
mit 30 Quadratmetern zur Verfügung, aber die Anlage hat jetzt einen
Kindergarten und einen Gesundheitsposten. Das Gemeinschaftszentrum wird
gerade eingerichtet. "In der kommenden OP-Runde wollen wir erreichen,
dass vor dem Viertel eine Polizeistation installiert wird," sagt
Oliveira, der vor 15 Jahren aus dem Hinterland von Rio Grande do Sul auf der
Suche nach Arbeit nach Porto Alegre gekommen ist.
Gleich
nebenan befindet sich ein städtisches Obdachlosenasyl, wo bis zu 40
"Straßenbewohner" vorübergehend untergebracht werden. Die 60-jährige
Delcy da Silva, die im nahegelegenen Stadtpark wohnt, wartet auf ein warmes
Essen. "Das Asyl ist nicht schlecht, aber es ist ein Tropfen auf den
heißen Stein," klagt sie. "Wir werden immer mehr."
Die
Stadtregierung könne die sozialen Probleme nur lindern, räumt Luciano
Brunet ein. "Natürlich wirkt sich die Wirtschaftskrise, vor allem die
Arbeitslosigkeit, auch auf Porto Alegre aus," sagt er. Die
brasilianischen Kommunen erhielten nur 17 Prozent aller Steuereinnahmen - im
Gegensatz zu Europa, wo dieser Anteil im Schnitt drei Mal so hoch sei.
Seit
Anfang 1999 steht Olívio Dutra der Landesregierung von Rio Grande do Sul
vor. Das südlichste Bundesland Brasiliens ist mit 280.000 Quadratkilometern
größer als der Nachbar Uruguay oder die alte BRD - allerdings wohnen hier
nur 11 Millionen Menschen. Nun setzt die PT-Landesregierung das OP auch im
weitgehend ländlich geprägten Flächenstaat um - eine "aufregende
Erfahrung", wie Iria Charão, Ministerin für die "Beziehungen zu
den Gemeinschaften" meint.
Die
vitale 56-Jährige macht nach eigenem Bekunden seit ihrem
Hauptschulabschluss vor 42 Jahren Basisarbeit und gehört zu Dutras
Mitarbeitern der ersten Stunde. Mit ihrem 50-köpfigen Team hat sie die
ehemalige neoklassizistisch angehauchte Residenz der Vizegouverneure
bezogen. "Das OP ist ein einziger großer Volksbildungsprozess,"
schwärmt die Ministerin. 190.000 Menschen hätten sich im ersten Jahr
beteiligt, dann erwirkte ein Abgeordneter der Opposition ein zeitweiliges
Verbot, das OP mit staatlichen Mittel zu propagieren. "Wir setzten auf
Mund-zu-Mund-Propaganda und sammelten Spenden für den Kauf der nötigen
Materialien," berichtet Charão. Und so sei trotz aller Behinderungen
die Beteiligung im vergangenen Jahr noch einmal um 50 Prozent gestiegen.
In
den 497 Gemeinden finden alljährlich Bürgerversammlungen statt. "Für
viele Menschen ist das die erste Chance gewesen, direkt mit
Regierungsvertretern zu reden," so die Ministerin, die Wert darauf
legt, den Prozess so oft wie nur irgend möglich vor Ort zu begleiten.
"Bei den Kaingang-Indianern oder in so mancher Gemeinde mit deutschstämmiger
Bevölkerung werden die Redebeiträge hin- und herübersetzt."
Auch
die Widerstände von Provinzfürsten, die ihre Pfründen in Gefahr sahen, hätten
nachgelassen. Allerdings würden noch längst nicht alle Vorgaben der
insgesamt 14.000 Delegierten umgesetzt, so etwa der Vorschlag, bei 30 Großunternehmen
zusätzliche Steuern einzutreiben. Die Opposition, die im Landesparlament
die Mehrheit hält, stellte sich quer. Es können längst nicht alle Bedürfnisse
der Bevölkerung befriedigt werden, denn die finanziellen Spielräume sind
auch auf Landesebene denkbar eng.
Selbst
politische Gegner der PT räumen ein, dass die hohe Transparenz bei den
Entscheidungsprozessen zu einer effektiveren Nutzung der knappen
Haushaltsmittel geführt hat. "Dadurch, dass die staatliche
Ausschreibungen offengelegt werden, sparen wir manchmal bis zu 30 Prozent.
Korruption ist praktisch unmöglich geworden," sagt Iria Charão.
"Außerdem fühlen sich die Menschen einbezogen und schlagen deswegen
oft originelle oder kostengünstigere Lösungen vor." Der
Politikwissenschaftler Denis Rosenfield lobt die durch das OP bestimmte
Sozialpolitik der Landesregierung. Doch andere Bereiche, etwa die Bildungs-
und Forschungspolitik, würden im Gegenzug vernachlässigt. Auch für die
Ansiedlung neuer Firmen sei noch kein stimmiges Konzept vorhanden.
Das
von der UNO und anderen internationalen Organisationen gepriesene OP hat in
Dutzenden brasilianischer Städte Schule gemacht und stößt auch in
Metropolen wie Barcelona, Bologna, Montevideo und Buenos Aires auf großes
Interesse. Die indische Wissenschaftlerin Vandana Shiva, Trägerin des
alternativen Nobelpreises, bezeichnete Rio Grande do Sul gar als "den
wahrscheinlich weltweit einzigen Ort, wo die Regierung macht, was die Bevölkerung
will" (mehr zum OP: .gov.br.)
Vom
Ereignis zum Prozess
Verständlich
also, warum die Initiatoren des Weltsozialforums sich letztes Jahr für den
Veranstaltungsort Porto Alegre entschieden. Die Idee zu einer
Gegenveranstaltung zum Weltwirtschaftsforum von Davos, wo sich seit 1971
alljährlich Manager, Banker und Politiker zum Gedankenaustausch treffen,
hatte der Ex-Unternehmer Oded Grajew aus São Paulo. Einen begeisterten
Mitstreiter fand er im Journalisten Bernard Cassen von Netzwerk
für die demokratische Kontrolle der Finanzwerke (ATTAC).
Sechs
Tage lang, vom 25. bis 30. Januar 2001, verwandelte sich Porto Alegre in
eine Hochburg der Globalisierungskritiker. Brasilianische Landlose und
Indígenas,
afrikanische Intellektuelle, Basisaktivisten aus Indien, nordamerikanische
Umweltschützer, französische Kommunalpolitiker, Feministinnen aus
Australien - ein bunter Haufen von "demokratischen Kosmopoliten"
(Flora Tristan) nahm an überfüllten Workshops, Podiumsdiskussionen und
Kulturveranstaltungen teil.
Aus
über 120 Ländern waren 4.700 Delegierte und etwa 10.000 zusätzliche
Teilnehmer gekommen. Der gewünschte Kontrast zu Davos stellte sich ein -
etwa in der Berichterstattung der großen französischen oder
brasilianischen Zeitungen. Eine transatlantische Videoschaltkonferenz geriet
zum polemischen Schlagabtausch zwischen Protagonisten aus Porto Alegre und
dem Großspekulanten George Soros, zwei UNO-Beamten und einem schwedischen
Unternehmer, die am Weltwirtschaftsforum beteiligt waren (komplettes
Protokoll unter www.madmundo.tv).
Porto
Alegre war der gelungene Versuch, an die Proteste anzuknüpfen, die seit dem
gescheiterten Ministertreffen der Welthandelsorganisation (WTO) von Seattle
im Dezember 1999 bei jedem größeren internationalen Gipfeltreffen
organisiert werden. Einig waren sich alle Beteiligten, dass die derzeitige
neoliberale Ausgestaltung der Globalisierung nur im Interesse einer kleinen,
aber mächtigen Minderheit liegt. Da aber öffentlichkeitswirksame Proteste
allein noch nicht ausreichen, wollte man in Brasilien schwerpunktmäßig an
der Formulierung von konstruktiven Alternativen arbeiten - nach dem
Tagungsmotto "Eine andere Welt ist möglich".
Mit von der Partie: Hunderte von Bürgermeister und Parlamentarier, die zu
entsprechenden Veranstaltungen im Rahmen des Forums angereist waren.
Die
Vertreter von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) aus aller Welt, die das
Gros der offiziellen Delegierten stellten, waren angetan von der Möglichkeit
zum Informationsaustausch und zum Diskutieren über das weitere gemeinsame
Vorgehen.
Aus diesem Grund versuchten die Veranstalter - acht brasilianische soziale
Bewegungen und NGOs - erst gar nicht, die Vielfalt der Anwesenden und ihrer
Vorstellungen in einem offiziellen Schlussdokument zusammenzufassen. Immer
wieder verteidigten sie diese Entscheidung als bewussten Ausdruck des
Pluralismus. Allerdings verabschiedeten hunderte von Organisationen einen
"Mobilisierungsaufruf", in dem die wesentlichen Anliegen der
allermeisten Forumsteilnehmer untergebracht sind (vgl.
die Homepage des Weltsozialforums: www.forumsocialmundial.org.br).
"Wir
bauen an einem großen Bündnis für eine neue Gesellschaft jenseits der
herrschenden Logik, wonach der freie Markt und Geld als einziger Maßstab
gelten," heißt es einleitend. Die Globalisierung verstärke ein
"sexistisches und patriarchales System" sowie den Rassismus.
"Luft, Wasser, Land und Völker sind zur Ware geworden." Gefordert
wird ein "bedingungsloser" Schuldenerlass, die "Reparation
historischer, sozialer und ökologischer Schulden", die Abschaffung von
Steuerparadiesen und die Besteuerung internationaler Finanztransaktionen
("Tobin-Steuer").
IWF,
die Weltbank und regionale Banken, die Welthandelsorgasiation WTO, die NATO
und andere Militärbündnisse seien "einige der multilateralen Agenten
der neoliberalen Globalisierung. Wir fordern ein Ende ihrer Einmischung in
die nationale Politik", lautet eine zentrale Passage der Erklärung.
Hier wird die Handschrift von Walden Bello deutlich. "Davos
ist die Vergangenheit, Porto Alegre die Zukunft," begannder
philippinische Soziologe sein flammendes Plädoyer für eine
Neuordnung des internationalen Handels- und Finanzsystems. Der Leiter des
Forschungszentrums Focus on the Global
South in Bangkok war ein Jahr zuvor noch selbst in Davos.
Für
ihn befindet sich die Bewegung der GlobalisierungskritikerInnen in einer
entscheidenden Phase: "Wir müssen hier das Tempo
aufrechterhalten," meinte er beschwörend, "dann können wir die
entscheidenden Schlachten gegen Welthandelsorganisation, Währungsfonds und
Weltbank gewinnen." Er sieht die "historische Chance"
gekommen, "hierarchische, undemokratische Institutionen" wie den
IWF, die Weltbank und die WTO weiter zu schwächen. Seine Alternative:
"Deglobalisierung". "Wir sollten uns nicht von der
Weltwirtschaft abkoppeln, aber wieder mehr für den internen Verbrauch
produzieren," so Bello. Auch die Abhängigkeit von ausländischen
Investionen und Finanzmärkten gelte es zu reduzieren. Ziel jeglicher
Politik müsse es sein, die Vielfalt menschlicher Gemeinschaften zu
respektieren und zu fördern.
Zu
schwach vertreten waren diesmal noch Mittel-, Nord- und Osteuropa, Asien und
Afrika und ganz allgemein der angloamerikanische Kulturkreis, ebenso
Gewerkschafter und Umweltschützer. Präsent,
allerdings nicht in den zentralen Debatten, waren Indígenas und
Jugendliche, die auf benachbarten Camps in der Stadt untergebracht waren,
sowie afrobrasilianische Aktivisten, die sich bitter darüber beklagten,
dass alle ihre Workshops an entlegenen Orten stattfanden.
Während die über 400 Workshops die ganze thematische Bandbeite der
Bewegung widerspiegelten, gelang die Zuspitzung in den 16 Podiumsrunden mit
nicht immer gut ausgesuchten Rednern nur teilweise. Nicola Bullard vom Focus
on the Global South bringt es auf den Punkt: Das Organisationskomitee könne
viel von der "wohlüberlegten geschlechts- und altersmäßigen,
ethnischen und sprachlichen Vielfalt" des Porto-Alegre-Teams bei der
Videokonferenz lernen: "Diese Gruppe spiegelte den 'Geist von Porto
Alegre' wider, im Gegensatz zur bizarren Auftaktspressekonferenz, die wie
eine Szene vom letzten Abendmahl wirkte. Zwölf Manner mit Bart, einer ohne,
saßen an einem langen Tisch. Eine Frau störte die biblische Einfalt
"(Focus on Trade 59, www.focusweb.org).
Auch
die Podiumsrunden wurden meist von "weißen, alten Männern"
bestritten. Darüber hinaus stieß die rigide Methode der Diskussionsführung
auf Kritik: Für Beiträge aus dem Publikum war kaum Zeit, und alle Fragen
mussten schriftlich eingereicht werden und den Filter des jeweiligen
Diskussionsleiters passieren. Ebensowenig transparent fiel die Entscheidung,
das nächste Weltsozialforum erneut in Porto Alegre auszutragen. Manch einer
störte sich an der unübersehbaren Präsenz der PT-Gastgeber, vor allem der
Landesregierung. Daher fand das brasilianische Organisationskomitee erst
buchstäblich in letzter Minute zu einem Kompromiss für 2002: Porto Alegre
ist wieder Schauplatz der Hauptveranstaltung (31.1.-5.2.2002), daneben soll
es Paralleltreffen in anderen Städten geben, und für 2003 wird ein neuer
Ort gesucht.
Dementsprechend
heißt es in der "Prinzipiencharta", die das Organisationskomitee
im April 2001 verabschiedete: "Das Weltsozialforum ist ein
ständiger Prozess der Suche und der Konstruktion von Alternativen". Ausdrücklich festgehalten wird die Ablehnung totalitärer und
reduktionistischer Geschichtsbilder, außerdem werden Organisationen
ausgegrenzt, die "als Methode politischer Aktion Menschenleben aufs
Spiel setzen".
"Eine
andere Welt ist möglich" war das Motto von Porto Alegre. Präziser
gibt das Diktum des Subcomandante Marcos von "einer Welt, in die viele
Welten passen" die Richtung vor. Es geht um die Ausweitung
basisdemokratischer Initiativen vor Ort - und das Orçamento
Participativo ist hier nur eines von unzähligen Beispielen -, aber auch
um die Demokratisierung des Weltsozialforums selbst (siehe auch The
Nation 19.3.2001, www.thenation.com).
Der
französische Philosoph Edgar Morin meint, noch sei in Porto Alegre keine
"zivilisatorische Politik für die Weltgesellschaft" formuliert
worden. Andererseits beginne sich auf der Gegenseite das
"Einheitsdenken zu pluralisieren", und das "Bewusstsein für
die Notwendigkeit einer Regulierung der Weltwirtschaft" habe selbst in
Davos Einzug gehalten. Er hofft auf eine produktive "Dialektik der
Antagonismen", ähnlich wie jene zwischen Arbeit und Kapital, die in
Westeuropa zum Wohlfahrtsstaat geführt habe. Diesmal gehe es darum, einen
ähnlichen Ausgleich auf globaler Ebene herbeizuführen, kurz: "die
Erde zu zivilisieren" (Libération,
5.2.2001. Zum Weiterlesen: www.monde-diplomatique.fr/dossiers/portoalegre,
das Libération-Dossier "Les
batailles de la mondialisation": www.liberation.fr/omc/index.html
sowie die fünfsprachige Homepage der Groupe d'études et de recherches sur les
mondialisations:
www.mondialisations.org).
Zur
Dialektik von Innovation und Widerstand
Um
diesen Prozess voranzutreiben, sei "Innovation und Widerstand" nötig,
sagte Waldon Bello. Was damit gemeint ist, führte geradezu exemplarisch die
Landlosenbewegung MST (www.mst.org.br)
vor. Sie nutzte die Anwesenheit der
Weltpresse, um höchst symbolträchtig zwei Hektar Gensoja auf einem
Versuchsgelände des Agrarmultis Monsanto im Hinterland von Porto Alegre zu
zerstören. Mit von der Partie: der französische Bauernsprecher José Bové,
dessen Buchtitel Die Welt ist keine
Ware zu den meistzitierten Slogans des Weltsozialforums avancierte. Dass
die brasilianische Regierung dem französischen Aktivisten mit Ausweisung
drohte, konnte er als Publicity-Erfolg verbuchen.
Zuvor
hatten
KleinbauernvertreterInnen von 30 der insgesamt 77 Ländersektionen, die im
Dachverband Vía Campesina in zusammengeschlossen sind, in Porto Alegre an
einer weiteren Vernetzung gearbeitet. Erfolgreich ist der Druck der MST auf
die Regierung, die von Anfang 1995 bis Mitte 2001 rund 500.000 Familien
angesiedelt haben will. Diese Zahl wird allerdings von jener der ländlichen
Kleinbetriebe übertroffen, die im gleichen Zeitraum bankrott gegangen sind.
Unter dem Strich geht die Landkonzentration weiter, sodass von einer
Agrarreform keine Rede sein kann. So lautet die Konsequenz für João Pedro
Stedile von der nationalen Leitung der MST, der auch im
Weltsozialforums-Organisationskomitee sitzt: "Das exportorientierte
Agrarmodell muss geändert werden."
Herr
Stedile, was ist Ihr Zwischenfazit drei Monate nach dem Ende des ersten
Weltsozialforums?
Porto
Alegre war ein Hafen für Menschen aus aller Welt, die sich vergewissern
wollten, dass es möglich ist, sich gegen das Kapital zu erheben. Es war ein
pluralistisches Treffen. Der Prozess ist zweigeteilt: Einige organisieren
Veranstaltungen, um alternative Vorschläge zu diskutieren. Andere wollen
eine internationale Protestbewegung gegen den Neoliberalismus
aufbauen.
Wie
haben Sie in Porto Alegre die so genannten "Ausgegrenzten" erlebt?
Die Bauernorganisationen waren sehr aktiv, aber andere, etwa Schwarze, Indígenas
oder Jugendliche aus den Armenvierteln der Städte, kamen nicht so recht zum
Zug. Der Diskurs wurde von Akademikern, Nichtregierungsorganisationen und
Politikern dominiert.
Auch
wir haben diese Selbstkritik geübt. Offensichtlich dominierten in Porto
Alegre die Weißen, der Westen, die über 30-Jährigen mit politischer
Erfahrung. Daher bestehen wir von der MST und von der Via
Campesina darauf, dass wir versuchen müssen, diesen Ideenaustausch in
unseren Ländern zu reproduzieren. Wir plädieren dafür, dass wir uns ab
dem kommenden Jahr an mehreren Orten treffen müssen, um die Möglichkeit zu
schaffen, dass eine Volksbewegung daraus wird, damit all jene, die in
sozialen Kämpfen stecken, an dieser Debatte teilhaben können.
Andere
kritisierten den "Reformismus", der in Porto Alegre dominiert
habe.
Das
Forum wurde weder von ultralinken Sektoren wie Trotzkisten oder Anarchisten
dominiert noch von der "rechten Linken". Natürlich gab es dort
sozialdemokratische, reformistische Kräfte. Aber die Forderung nach
radikalen Änderungen war der zentrale Kern, um den sich die Debatten
drehten. Das Forum war klar: Man darf die Auslandsschulden nicht bezahlen.
Wir müssen sehen, was die Botschaft für die Gesellschaft war. Ich bin
sicher, der internationalen Bourgeoisie hat Porto Alegre kein bisschen
gefallen.
Auffällig war,
wie dünn viele Regionen der Welt noch vertreten waren.
In
Europa haben wir ein Problem. Die Gewerkschaftsbewegung steckt in großen
Schwierigkeiten. Für Porto Alegre hat ATTAC mobilisiert, keine soziale
Bewegung. Schwierig ist es aber auch in Afrika, Asien und der arabischen
Welt. Bei aller berechtigter Kritik am Treffen: Es geht vor allem darum, den
Prozess zu sehen, und der muss sich ausweiten.
Daher
auch die Idee weiterer Paralleltreffen, die zeitgleich zu Porto Alegre 2002
stattfinden sollen.
Die
Leute werden angeregt, nationale Komitees zu bilden. In Dutzenden von Ländern
ist man dabei, dies zu tun, als erster Schritt. Zu parallelen Treffen könnte
es zum Beispiel in, Bangkok, Quito, Dakar und in den USA kommen. Vier, fünf
Orte sind realistisch, wenn nicht zeitgleich mit Porto Alegre, dann
vielleicht ein paar Tage vorher.
Ein
Kristallisationspunkt für die Linke in ganz Amerika ist die geplante
Freihandelszone von Alaska bis Feuerland (FTAA, span. ALCA), die ab 2006 in
Kraft treten soll. Was kann ihr entgegengesetzt werden?
Die
ALCA ist ein Projekt der US-Multis, um den lateinamerikanischen Markt noch
besser berherrschen zu können.Wenn es den USA gelingt, die ALCA
durchzusetzen, werden sie einen langen Kampf um die nationale Souveränität
auslösen. Zentral sind dabei die großen Länder, die sich dem
entgegenstellen könnten. Aber Mexiko ist praktisch schon drin. Und auch
Argentinien ist bereits eine Geisel der USA, weil es seine Wirtschaft
dollarisiert hat.
Die
große Herausforderung ist also Brasilien. Die Frage ist, ob es uns in den nächsten
drei Jahren gelingt, die Massenbewegung wieder zu entfachen. Wir können die
ALCA nur aufhalten, wenn das Volk auf die Straße geht. Wir brauchen ein
wenig historische Geduld. Die Zeit zwischen 1974 und 1978 war so ähnlich
wie jetzt. Das Volk hatte die Nase voll von der Diktatur, aber man ging noch
nicht auf die Straße. Ich bin zuversichtlich, dass es in zwei, drei Jahren
soweit ist. Und dann sind es 10 Millionen, das ist ein anderes Kaliber als
unsere Spaziergänge...
Auch
der Widerstand gegen den Plan Colombia wird immer wieder als gemeinsames
Anliegen der lateinamerikanischen Linken genannt. Aber wie soll das konkret
aussehen?
Die
brasilianische Linke ist sich der US-Intervention bewusst, doch sie ist
nicht in der Lage, dazu zu mobilisieren, denn die meisten Brasilianer wohnen
an der Küste und nicht in Amazonien. Eher noch glaube ich, dass man die über
Rolle der Multis bei der Gentechnik oder den Patentgesetzen an die Leute
herankommt. Ich glaube, die einzige Chance gegen den Plan Colombia haben
wir, wenn es eine Rebellion in Ecuador gibt. Dann könnten sich die Kräfteverhältnisse
im andinen Raum verschieben. Wenn dagegen in Kolumbien das Pendel in die ein
oder andere Richtung ausschlägt, dann könnte es zu einem Bürgerkrieg in
ungekanntem Ausmaß kommen.
Von
der kolumbianischen Guerilla gehen ja keine innovativen Impulse aus, ganz im
Gegensatz zu den Zapatistas. Kommen die zum nächsten Weltsozialforum und
werden sie die Diskussion bereichern?
Bestimmt.
Aber ich fürchte, der Zapatismus hat sich letztlich auf die Frage der
Autonomie für die indigenen Völker reduziert. Doch für den Kampf gegen
das internationale Kapital müssen die Massen mobilisiert werden. In dieser
Hinsicht sind die Zapatistas hinter den Erwartungen zurück geblieben,
sicher auch, weil sie jahrelang in Chiapas eingeschnürt waren.
Zurück
zur Gentechnik. Warum, meinen Sie, eignet sie sich besonders gut zur
Bewusstseinsbildung?
Sie
bringt die Konsumenten in den Städten und die Bauern zusammen. Bei Gensoja
und Genmais gibt es ungeklärte Risiken für Gesundheit und Umwelt. Und wenn
die Multis eine Monopolstellung beim Saatgut erlangen, bedeutet das das Ende
für die Kleinbauern. Sie werden zu Pächtern degradiert, und die Multis
entscheiden über Technik und Saatgut. Die Kleinbauern wissen um die
Bedeutung des Saatgutes für ihre Autonomie. Schließlich kommt das Thema
auch in Europa und Nordamerika gut an.
Zum
Schluss: Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen der Landlosenbewegung und
der brasilianischen Regierung?
Das
ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Wir versuchen, der Katze den Käse zu klauen,
und wenn die Katze uns schnappt, dann frisst sie uns. Aber wir sind noch
nicht stark genug, um der Katze die Schelle um den Hals zu hängen. Wir tun
alles, um gegen Symbole des Wirtschaftsmodells zu kämpfen. Wir verfolgen
damit auch eine pädagogische Absicht für all jene, die noch kein
Bewusstsein darüber haben. So hoffen wir, immer mehr Leute gegen die
Regierung aufzubringen. Wir müssen also die Katze schlagen und fliehen, das
ist eine Pendelbewegung.
Für
die Regierung scheint die MST der Lieblingsfeind zu sein...
Ja,
sie setzt ihr Agrarmodell mit Biegen und Brechen durch. Sie will ganz
offensichtlich keine Agrarreform im klassischen Sinn durchführen, sondern
uns als politische Organisation besiegen. Anders als während der Militärdiktatur
geht es weniger um nackte physische Gewalt. Jetzt läuft die Repression über
die Justiz. Es sind 180 Verfahren gegen uns anhängig. Dazu kommen die
Bespitzelung durch die politische Polizei und die Kampagnen in den
Massenmedien, durch die die Gesellschaft gegen uns aufgebracht werden soll.
Trotz
dieser Offensive der Regierung leisten wir Widerstand und schaffen neue Bündnisse.
Auch wenn wir keine spektakulären Erfolge gehabt haben, steigt die Anzahl
der Mobilisierungen. Um den internationalen Frauentag herum gab es die
bisher größten Aktionen von Bäuerinnen, und gleich danach von der
Bewegung gegen Staudämme. Manchmal müssen wir Landlose diese quasi
feuerwerksartigen Aktionen machen, wie die Zerstörung des
Monsanto-Versuchsfeldes oder die Besetzung eines Landgutes des
brasilianischen Botschafters in Italien. So machen wir die Leute auf die Lügen
der Regierung aufmerksam.
« zurück zur Übersicht
|