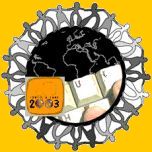| |||||
BerichteWie weiter nach dem 5. Weltsozialforum? Attac und andere zwischen Porto Alegre und Erfurt
(von Philipp Hersel, Attac Deutschland) Dieser Artikel gliedert sich in vier Teile. Der Teil 1 berichtet vom WSF und zieht v.a. Schlüsse hinsichtlich der neuen Methodologie des Forums und ihrer Weiterentwicklung. Der zweite Teil berichtet vom europäischen und internationalen Attac-Treffen und der Zukunft des globalen Netzwerks. Teil 3 stellt die Frage, wie sich Attac-D und Attac-International strategisch in der globalen Sozialforumsbe-wegung positionieren wollen. Teil 4 überlegt, wie wir es als Attac schaffen, den Zusammenhang von lokaler und weltweiter Sozialforumsbewegung in D, insbesondere mit Blick auf das Sozialforum in Deutschland im Juli in Erfurt, zu vertiefen.
Vom 26.-31. Januar 2005 fand in Porto Alegre/Brasilien das fünfte Weltsozialforum mit über 150.000 TeilnehmerInnen aus 135 Ländern statt. In über 2500 Veranstaltungen haben ca. 7000 Menschen Refe-rate und Präsentationen vorgetragen. Das fünfte WSF war, nicht zuletzt bedingt durch die Erfahrungen des vierten WSF in Mumbai/Indien im vergangenen Jahr, durch eine methodologische Generalüberholung gegangen. Sichtbare Neuerungen Die schon im Vorjahr zurückgedrängten, bis dahin vom WSF-Vorbereitungskomitee zentral organi-sierten Großpodien (mit mehreren tausend ZuschauerInnen) an den Vormittagen wurden abgeschafft und die Trennung unterschiedlicher Veranstaltungsformen zwischen Vor- und Nachmittag aufgeho-ben. Es gab daher nur “selbstorganisierte” Veranstaltungen mit Räumlichkeiten bis zu einer TN-Zahl von ca. 1000 Personen. Alle Organisationen, die sich als Mitträger des WSF registriert hatten (Regist-rierungsgebühr ca. 100 € für Organisationen aus OECD-Ländern, 50€ aus Nicht-OECD-Ländern), konnten entweder eigenständig oder in Zusammenarbeit mit anderen Gruppen solche “selbstorgani-sierten” Veranstaltungen anbieten. Zwar wurde die Abkehr von den großen Podien von der Mehrzahl der TeilnehmerInnen begrüßt, sie hinterließ aber zugleich auch ein gewisses Vakuum. Denn einerseits waren die Podien ein wichtiger Anlaufpunkt für Journalisten, die angesichts der Vielzahl von mehren tausend Veranstaltungen gerne als Leitfaden und inhaltlichen Zugang zum Forum genutzt wurden und die diesmal an der Undurch-dringlichkeit der Programmvielfalt schier verzweifelten. Die zweite Lücke klaffte an der Stelle, wo die WSF-organisierten Podien zumindest methodisch bisher die Möglichkeit boten, systematisch unter-schiedliche, kontroverse und gegensätzliche Positionen auf einem Podium zu versammeln und dadurch Diskussionsprozesse in der Bewegung nachzuzeichnen. Dies war in der Vergangenheit zwar auch nur selten gelungen, aber bei den “selbstorganisierten” Veranstaltungen waren die Veranstalter oft wenig gewillt, in der Bewegung politisch Andersdenkende einzubeziehen. Das führte nicht selten dazu, dass parallel drei Veranstaltungen zum selben Thema stattfanden, in denen sich jeweils bestimmte Teile und Flügel der Bewegung isolierten, statt einmal offen über ihre Differenzen und Widersprüchlichkei-ten zu reden. In dieser Hinsicht hat Attac-D einen interessanten Kontrapunkt gesetzt: Mit der Veran-staltung “Agreements and Disagreement in the international Debt Movement. How to understand them, how to respect them, how to deal with them?” haben wir bewiesen, dass eine fruchtbare und nicht-selbstzerfleischende Bearbeitung bewegungsinterner Differenzen möglich ist und den Vorberei-tungsaufwand lohnt. Hier war es Attac-D gelungen, seit September letzten Jahres eine bemerkenswerte Breite an politisch durchaus unterschiedlich orientierten Organisationen und Netzwerken der internati-onalen Schuldenszene in die Vorbereitung einzubeziehen . Die zweite sehr sichtbare Änderung im Vergleich zu den bisherigen Weltsozialforen in Porto Alegre war die Zusammenführung des gesamten Forums auf einem gemeinsamen Territorium in der Nähe des Stadtzentrums. Hatte das WSF bis 2003 zu einem großen Teil in der katholische Universität stattge-funden, so zog sich das Veranstaltungsgelände nun über ca. 4 km entlang des Lago Guaiba, einer rie-sigen Binnenlagune. Diese Entscheidung war auch von der Hoffnung getragen, die Eintrittsschwelle zum Forum zu verringern, denn die “professionelle” und technische Infrastruktur der Uni wurde von vielen der basisorientierten TeilnehmerInnen aus ärmeren Milieus als sehr elitär, intellektuell abgeho-ben und politisch entrückt erlebt. Durch die inhaltlich-territoriale Gliederung war der Zugang zu den einzelnen Themen sehr viel einfa-cher als früher. Wer sich wirklich auf einen Themenbereich konzentrieren wollte, der musste über den ganzen Zeitraum “sein” thematisches Territorium kaum verlassen. Dieses Angebot war für viele wohl ziemlich verlockend angesichts eines Veranstaltungsprogramms, das im gedruckten Format die Form von zwei jeweils 130-seitigen Zeitungen (plus 20 Seiten Kulturbeilage) annahm und erst am Beginn des Forums verfügbar war. Eine gründliche Durchsicht des gesamten Programms mit anschließender persönlicher Veranstaltungsauswahl war unter solchen Umständen ohnehin unmöglich, denn das hätte mindestens einen kompletten Tag in Anspruch genommen. Wer sich schon von Deutschland die Pro-grammentwürfe im Internet mitgenommen hatte, war da zwar schon deutlich besser dran, war aber dann praktisch die gesamte Anreise über beschäftigt und hatte ein paar Kilo Papier zusätzlich im Handgepäck.
Neben den oben genannten Änderungen hat die Konsultation und die nachfolgende Formulierung ei-ner neuen WSF-Methodologie im Sommer letzten Jahres noch einige andere sehr wichtige Aspekte beinhaltet. Auch was die inhaltliche Vernetzung im Vorfeld bei der Programmplanung angeht, hatte man sich mit der neuen Methodologie viel vorgenommen. So sollten alle Veranstaltungswünsche bis Mitte Novem-ber registriert werden, damit danach ein Prozess der Vernetzung, Zusammenlegung, Abgleichung und Abgrenzung von Veranstaltungen in ähnlichen Themenbereichen erfolgen kann (die sogenannte “Ag-glutinierung”). Praktisch sollte dadurch erreicht werden, dass nicht (wie vielfach üblich) fünf Veran-staltungen mit fast demselben Thema völlig unabhängig und an einander stattfinden, sondern dass die Veranstalter auf die Überschneidungen hingewiesen werden und allein schon dadurch eine inhaltliche Vernetzung initiiert werden kann. Ob diese dann tatsächlich Veranstaltungen fusionieren, sich inhalt-lich besser auf einander beziehen oder sich abgrenzen etc., wollte die neue Methodologie aber den Veranstaltern selbst überlassen. Zum Zwecke der Agglutinierung sollten von zwei Kommissionen des Internationalen Rats sogenannte “Aggregate Groups” für einzelne Themenkomplexe gebildet werden, die die Veranstalter in den unterschiedlichen Komplexen zu genau dieser Vernetzung einlädt und da-bei unterstützt. Zur Stärkung der Handlungsorientierung wurde neben der Agglutinierung noch eine weitere methodi-sche Neuerung vorgesehen: die sogenannte “Mural de propostas”. Hierbei handelt es sich um eine Art dezentralem Schwarzen Brett, wo während des Forums in den unterschiedlichen Terrains konkrete Vorschläge, Verabredungen, Beschlüsse etc. zusammengetragen werden sollten. Auf diese Weise soll-ten die Ergebnisse der tatsächlich stattfindenden Vernetzungen und die konkreten Vorschläge und Beschlüsse (die z.B. bei Diskussionsveranstaltungen entstehen) stärker sichtbar ins Forum hineinge-tragen werden. In jedem thematischen Terrain stand eine solche “Mural de propostas”, also eine Pinn-wand und ein dazugehöriger Computer mit HelferIn, um die Vorschläge etc. in ein vorgegebenes For-mular einzutragen, auszudrucken und dann aufzuhängen. Die konkreten Eingaben wurden dadurch sogleich elektronisch erfasst und virtuell zu einer Gesamt-Mural des Forums gebündelt. Wie weiter mit der neuen Methodologie? Zweifellos gehen alle der bisher genannten Neuerungen in die richtige Richtung, allein ihre Umset-zung bereitet noch einige Schwierigkeiten. Da es aber das erste WSF mit der neuen Methodologie ist, sollte das nicht entmutigen. Wo die neue Methodologie in der Praxis ankam, hat sie wesentliche Bei-träge zum Forum geleistet. In Zukunft muss noch mehr Energie darauf verwendet werden, die Teil-nehmerInnen über methodologische Weiterentwicklungen zu informieren, damit Angebote wie die Muras auch tatsächlich angenommen werden. Eine konsequente Umsetzung und Weiterentwicklung der neuen Methodologie birgt aber auch eine Gefahr mit sich, nämlich ein noch stärkeres Auseinanderfallen der unterschiedenen Typen von Teil-nehmerInnen und Zielgruppen. Überspitzt gesagt gibt es zwei Arten von TeilnehmerInnen. Auf der einen Seite sind die interessierten Erstbesucher, die einfach einmal selbst miterleben wollen, wovon sie bisher nur gehört hatten. Für diese Gruppe spielt das Eintauchen in eine kleine “andere Welt” und in die Atmosphäre des Forums eine oftmals größere Bedeutung als die inhaltliche Konzentration auf bestimmte Themen und die Frage, mit welchen Arbeitsergebnissen sie nach Hause zurückkehren. Der andere Typus an TeilnehmerInnen sind die “WiederholungstäterInnen”, die zum wiederholten male bei einem Forum dabei sind und die mit sehr viel konkreteren Erwartungshaltungen anreisen. Häufig sind sie Delegierte von Organisationen, sind häufig in die Vorbereitung von Veranstaltungen einge-bunden und haben nicht selten ein strategisches Interessen, auf dem Forum bestimmte Ergebnisse zu erreichen.
Die Begegnung mit Attac-International beim WSF erfolgt idealtypisch bei der Auftaktdemonstration, bei der des auch diesmal einen kleinen Attac-Block (ca. 200 Leute) gab. Hier sieht man an den Trans-parenten und Flyern gleich, was den unterschiedlichsten Attacies gerade unter den Nägeln brennt. Bei den lateinamerikanischen Attacs ist das v.a. die pan-amerikanische Freihandelszone ALCA und natür-lich die Verschuldungsfrage, Attac-Japan verteilte Flugblätter gegen die geplante Privatisierung der Post, Attac-Frankreich mobilisierte gegen die neoliberale Politik und den Verfassungsentwurf der EU und zwei Attacies aus Deutschland waren froh, dass ihnen die Franzosen eine Fahne überließen. Während es beim europäischen Treffen hauptsächlich um einen Austausch und eine Vernetzung rund um die Themen EU-Verfassung, Bolkestein und einen Erfahrungsaustausch zwischen lokalen Gruppen in Arbeitsgruppen ging, gab es beim internationalen Treffen drei AGs 1. zu Austausch und Kooperati-onsmöglichkeiten mit Blick auf inhaltliche Schwerpunkte und Kampagnen, 2. Zur Aktualisierung der internationalen Attac-Plattform und 3. zur Verbesserung der internationalen Kommunikation und Ko-ordination. Letztere AG hat beschlossen, dass wir endlich eine internationale e-mail-Liste einrichten wollen, auf der sich Delegierte versammeln, die tatsächlich dafür Sorge tragen, dass die Infos und Koordinationsfragen auch tatsächlich bei den nationalen Attacs ankommen und von dort zurück auf die Liste kommen (bisher haben wir nur eine völlig unverbindliche globale e-mail-Liste, die besten-falls gelegentlich ein paar Informationen austauscht). So geringfügig es klingen mag, aber die Bereit-schaft zur Einrichtung einer solchen Liste ist politisch tatsächlich ein qualitativer Schritt nach vorn, nun bleibt die Umsetzung dieses Beschlusses abzuwarten. Attac-Frankreich hat die Einrichtung ange-boten und die gemeinsame AG Internationales von Attac-Rat und Ko-Kreis will dort Unterstützung anbieten. Zentral für die Funktionsfähigkeit dieser Liste wird sein, sie zweisprachig auf englisch und spanisch zu organisieren. Das stellt sowohl technische wie übersetzungsmäßige Herausforderungen, die noch nicht gelöst sind. Wie üblich war die Aufbruchstimmung bei dem Treffen zunächst groß, aber die TeilnehmerInnen sind inzwischen vom WSF in die Mühen der Ebene zurückgekehrt und viele Verabredungen drohen dann schnell, im Sande zu verlaufen. Die AG Internationales will sich in dieser Hinsicht engagieren und am Ball bleiben.
Wenn die Vernetzung globaler sozialer Bewegungen insgesamt und im Rahmen des WSF im Beson-deren voranschreiten soll, dann müssen dafür deutlich mehr Ressourcen eingesetzt werden. Das bedeu-tet zum Einen, dass auf Vernetzung orientierte Gruppen mit handlungsfähigen Delegationen anreisen müssen, damit man sich systematisch zur Verfolgung bestimmter Themenbereiche aufteilen kann, und damit Teile der Delegationen neben den Veranstaltungen tatsächlich freie Kapazitäten für spontane Netzwerktreffen, für die Kommunikation mit den Gruppen zu Hause und mit der Presse, für die direk-te Rückkopplung von Ergebnissen ins Forum und vieles andere mehr haben. Mit der Reise von Dele-gationen ist es aber nicht getan. Eine handlungsorientierte Vernetzung beim WSF ist nicht mehr wert als die personellen Kapazitäten, die wir in der Vor- und Nachbereitung solcher Treffen stecken. Ei-gentlich kann das WSF nur ein Treffen im Laufe einer kontinuierlichen Arbeit sein, genau so, wie Attac-Arbeit eben nicht nur auf einem Ratschlag stattfindet. Unsere Kapazitäten in dieser Hinsicht sind aber bisher völlig unzureichend ausgeprägt. Angesichts unserer auch sonst nicht gerade überbor-denden personellen Ressourcen ist daher die Frage unseres zukünftigen Engagements und unserer Rolle in der internationalen Vernetzung sozialer Bewegungen eine strategische Prioritätenfrage. Wir müssen dabei mitbedenken, dass Attac als noch recht junges Netzwerk dabei eine sehr hohe Repu-tation und großes Vertrauen genießt. Gerade weil Attac wie kaum ein anderes Netzwerk große politi-sche Pluralität in sich vereinigt, und darüber hinaus auch ein nicht nur nationales, sondern internatio-nales Netzwerk ist, könnte Attac auf internationaler Ebene an manchen Stellen die Rolle des Modera-tors und Katalysators bei der Herausbildung von Allianzen und Bündnissen spielen, wie wir es für das Zustandekommen der Großdemonstrationen am 3.4.2004 auf bundes- und ansatzweise europäischer Ebene gespielt haben.
Am WSF haben 50 deutsche Organisationen mitgewirkt, mehrere hundert Menschen aus Deutschland waren beim WSF. Vom 21.-24. Juli dieses Jahres findet erstmalig ein bundesweites "Sozialforum in Deutschland" (SFiD) in Erfurt statt. Obschon sich beide Prozesse direkt und unmittelbar als Teil der weltweiten Sozialforumsbewegung verstehen, ist es keineswegs selbstverständlich, dass die Organisa-tionen, die das weltweite und die kontinentalen Sozialforen begleiten und besuchen, auch in den bun-desweiten Prozess für ein SFiD einbezogen sind. Dies liegt nicht zuletzt daran, weil sich im Falle des SFiD gerade zwei unterschiedliche Ebenen treffen müssen, die bisher nur ungenügend vernetzt sind (die folgende Unterscheidung bezieht sich dabei nur auf die Bundesrepublik, nicht notwendigerweise auf Sozialforumsprozesse in anderen Ländern). 1. Zur ersten Gruppe gehören die Organisationen, die die weltweite Sozialforumsbewegung seit dem ersten WSF in Porto Alegre in 2001 oder danach als weltweiten Prozess verfolgen und sowohl durch ihre inhaltliche Ausrichtung (z.B. als entwicklungspolitische Organisationen und Hilfswerke) oder ihre Arbeitsbereiche in Organisationen (z.B. die internationalen Abteilungen in Gewerkschaften und politi-schen Stiftungen etc.) automatisch für internationale Arbeit und internationale Vernetzung (inkl. inter-nationaler Reisetätigkeit) zuständig sind. 2. Auf der anderer Seite gibt es eine Vielzahl von Gruppen, die ihre Aufgabe in erster Linie darin se-hen, sich auf lokaler und regionaler Ebene im Geiste der Sozialforumsbewegung als Diskursraum und auch als Bündnis zu vernetzen. Diese Gruppen sind in der Regel stärker in lokale Zusammenhängen eingebunden und nehmen nicht selten für sich in Anspruch, im Verhältnis zur ersten Gruppe die au-thentischere "Basis" der Sozialforumsbewegung zu sein. Die Trennung zwischen den beiden Ebenen wird zwar im Einzelfall überwunden, z.B. wenn Menschen aus lokalen Sozialforen aus der Bundesrepublik zum WSF fahren, oder wenn ReferentInnen bundes-weiter Organisationen vor Ort aus Porto Alegre berichten. Im Großen und Ganzen muss man aber feststellen, dass die Trennung sehr ausgeprägt ist und sie durch die Organisationsformen der beiden Ebenen (lokale, ehrenamtliche, finanzschwache Strukturen versus bundesweite, i.d.R. hauptamtliche und finanziell potentere Organisationen) regelmäßig reproduziert wird. Es gibt nur wenige Gruppen, die zwischen diesen beiden Welten wandeln. Noch viel schwieriger ist es, tatsächlich eine Verbindung zwischen den Welten herzustellen. Attac wird oft von beiden Seiten als ein Kommunikationskanal und eine Brücke zwischen den Ebenen angesehen, eine Rolle, die uns aber mehr als nur überfordert. Der Vormarsch neoliberaler Politik (sei es nun in Form von wachsender Verarmung und IWF-Strukturanpassung im Süden, als Privatisierung von Wasser in Nord und Süd oder als Agenda 2010 in der Bundesrepublik) ist nur in Nord und Süd gleichzeitig zu stoppen. Es wird keine positive Entwick-lung, weder sozial noch ökologisch, im Süden geben, wenn die negativen Entwicklungen im Norden weitergehen und sich verschärfen. Denn der Norden beherrscht die globalen Strukturen, unter denen Entwicklung im Süden stattfindet.Umgekehrt: Ohne die ermutigenden Signale und Freiräume, die von Bewegungen aus dem Süden wie den Landlosen- und Kleinbauernbewegungen, von Gewerkschaften oder von den Zapatisten ausgehen und von ihnen unter Einsetzung ihres Leben erkämpft werden, geht den sozialen Bewegungen und Organisationen im Norden schlicht die Puste aus, ihre Arbeit für struk-turelle Veränderungen fortzusetzen. Zwar wäre es verkürzt zu behaupten, dass die bundesweiten und auf den WSF-Prozess-bezogenen Organisationen in D ausschließlich für die sozialen Kämpfe im Süden, und die lokalen Sozialforen nur für die sozialen Kämpfe im Norden stehen. Aber zumindest ist es bei den aufs WSF-orientierten Gruppen keineswegs selbstverständlich, sich auch aktiv in der Bundesrepublik kritisch mit der Frage neoliberaler Politik zu beschäftigen. Eine weltweite Sozialforumsbewegung kann aber nicht funktio-nieren, wenn viele der Beteiligten jeweils nur die globalen (oder enger: Nord-Süd-politischen) oder primär lokale Aspekte im Auge haben. Derzeit stellt sich diese Situation gerade mit Blick auf die Vor-bereitung des ersten “Sozialforums in Deutschland” aber genau so dar: viele lokale Sozialforen fragen sich einerseits, wozu sie überhaupt ein bundesweites Sozialforum brauchen und die beim WSF aktiven bundesweite kirchliche Hilfswerke, Gewerkschaftsgliederungen und Nord-Süd-Organisationen ande-rerseits sehen Erfurt keineswegs selbstverständlich als Ort, um sich politisch einzubringen. Der derzeitige Prozess für ein Sozialforum in Deutschland könnte und müsste ein wichtiger Kristalli-sationspunkt sein, um Kirchen, Gewerkschaften und soziale Bewegungen, nicht nur aus der Bundesre-publik, zusammenzubringen, um die "soziale Frage" global, d.h. sowohl für den Norden wie für den Süden, parallel zu bearbeiten. Leider ist bisher keineswegs sichergestellt, das es auch dazu kommt. Hier kann und muss Attac vermitteln, aber unsere Möglichkeiten und Ressourcen sind sehr gegrenzt. Bis Juli ist nicht mehr viel Zeit, um das SFiD in Erfurt zu einem Erfolg zu machen. Alle Beteiligten haben sehr begrenzte Ressourcen und so hat auch Attac-D lange gezögert, sich den Schuh anzuziehen und sich um eine Bündelung der beim WSF-aktiven Kräfte zu bemühen. Wenn wir unserem Ziel einer anderen Welt näher kommen wollen, dann führt an einem deutliche Impuls Richtung Erfurt aber wohl kein Weg vorbei. |
|||||
Aus www.weltsozialforum.org, gedruckt am: Do, 17.04.2025
© |
|||||