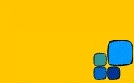Berichte
Die zweite Supermacht
Früher gab es in indischen Dörfern zwei Zisternen: Aus der einen schöpften die jungen Frauen das Wasser, die andere hingegen ließen sie unberührt. Wer aus dieser zweiten Zisterne schöpfe, so hieß es, werde keinen Mann bekommen.
Diese Geschichte erzählte eine Inderin auf dem Weltsozialforum (WSF) in einem Seminar über die Privatisierung der Wasserrechte, das vornehmlich von Indern besucht war. Es stecke hinter diesem Brauch mehr als ein Aberglaube, sagte die Frau: Solche Geschichten hätten die Menschen Respekt vor Wasser gelehrt. Heute sei das verloren: Seien die Inder unter der englischen Kolonialherrschaft politisch versklavt gewesen, so seien sie es heutzutage mental.
Unter den Besuchern dieses Seminars waren viele Inderinnen, darunter auch solche, die nicht lesen noch schreiben können. Sie haben an jenem Nachmittag viel gelernt: Politische Erziehung sei eines der Ziele des WSF, sagte Lalit Surjan, Chefredakteur einer Tageszeitung, die mit einer Auflage von 150 000 Exemplaren in dem großen Land als unbedeutend gilt. Die Frauen werden in ihre Dörfer zurückkehren und erzählen, was sie gehört haben über die Privatisierung des Wassers, über die Dürre, unter der die Bauern leiden, deren Wasserrechte an fremde Investoren verkauft wurden. Vielleicht wird ihnen jemand zuhören.
Die Organisatoren des Forums wollten das Treffen, das bisher im brasilianischen Porto Alegre stattfand und eine westlich-lateinamerikanisches Veranstaltung war, auf Asien ausweiten. Das ist insofern gelungen, als etwa die Hälfte der 100 000 Besucher in Bombay (offiziell Mumbai genannt) aus allen Teilen Indiens herbeigereist waren. Auch aus Südkorea, aus Japan und anderen südostasiatischen Staaten waren die Leute gekommen, allerdings nicht so viele, wie die Organisatoren gehofft haben mögen.
Die Sehnsucht nach „einer anderen Welt“, die im Motto des WSF herbeigerufen wird, ist in Indien ist umso größer, als die Mehrheit der Bevölkerung von den Berufspolitikern nichts mehr hält. Indira und Rajiv Gandhi hätten immerhin noch „zu zwanzig Prozent“ das Wohl des Landes im Auge gehabt, erklärte ein Mann aus Bombay, die jetzige Regierung hingegen sorge sich ausschließlich um sich und ihre Klientel. Viele Besucher des Forums haben mehr Engagement als Bildung. Sie interessierten sich besonders für die Themen, die ihr Leben bestimmen: Das Wasser, die Erde, die Landwirtschaft, die Rechte der Arbeiter. Abstrakte Sujets wie die Auswirkungen der Globalisierung oder das Wirken der Welthandelsorganisation überließen sie der intellektuellen Internationale am Ort.
Joseph Stiglitz, der vormalige Vizechef der Weltbank, jetzt Ikone der Globalisierungskritiker, hielt eine Rede gegen die Liberalisierung der Kapitalmärkte: Eine modifizierte Tobin-Steuer – die Besteuerung von Devisengeschäften – sei notwendig, um Währungsspekulationen zu begrenzen, die zuerst auf Kosten der Armen des betroffenen Landes gehen. Weltweit wurde berichtet, dass die Schriftstellerin Arundhati Roy für einen Boykott der Unternehmen plädierte, die vom Wiederaufbau des Irak profitieren. Der andere Teil ihrer Rede ging hingegen unter: Sie sprach von den Massakern, die Indiens Hindus an den Moslems verüben – unter den wohlwollenden Blicken der Polizei, die gegen die Pogrome nicht einschreitet. Wenn es denn so sei, dass ethnisch begründete Massenmorde eine amerikanische Militärintervention rechtfertigten, sagte Arundhati Roy, dann sei auch Indien ein Schurkenstaat, der demnächst bombardiert werden müsse. Bei Indiens Hindus kommt die couragierte Frau mit solchen Worten nicht gut an. In der Weltpresse, die sich um die Verhältnisse in Indien wenig bekümmert, wurde sie für ihren Boykottaufruf kritisiert.
Die Arbeit des Lichtmeisters
Das WSF sei zu chaotisch gewesen, heißt es jetzt allenthalben, es habe keine Ergebnisse gezeitigt und drohe, im Wust der Vielfalt zu ersticken. Tatsächlich sind allenfalls die Stimmen der Redner erstickt, die eine unzureichende Lautsprecheranlage oder gar kein Mikrophon zur Verfügung hatten. Die Kosten für die Ausrichtung des Forums betrugen rund 1,5 Millionen Euro. Das meiste Geld spendeten zwei holländische Hilfsorganisationen und die britische Oxfam. Mit so knappen Mitteln lässt eine gute Akustik für 100 000 Leute sich nicht finanzieren.
Die indischen Freunde des Weltsozialforums haben getan, was sie konnten. Größer als ein Fußballfeld ist der Versammlungsplatz auf der für das WSF wiederbelebten industriellen Brachhalde: Damit die Zuhörer sich ohne Gefahr für ihre Kleider niederkauern konnten, war der ganze Platz mit von Hand zusammengenähtem Sackleinen bedeckt. Die Zelthallen für die mehr als tausend Seminare waren aus Bambusrohr, Hanfseilen, Tuch und teils auch aus Wellblech gebaut. Es gab Abendveranstaltungen, bei denen die Arbeit des Lichtmeisters darin bestand, in einem Baum zu hocken und zwei Kabelenden zusammenzuhalten. Es gab polyglotte Seminare, bei denen Freiwillige aus dem Publikum als Übersetzer fungierten. Es gab Tipps, wie die überfluteten Toiletten doch noch zu benutzen seien, diskret, ohne Rücksicht auf Hautfarbe oder Herkunft von einem Wartenden an den nächsten weitergegeben. Was es nicht gab, sechs Tage lang, waren Drängelei und Rempeleien. Keine Rede konnte sein von einer übermächtig wogenden Menschenmenge: Da hat jeder einzelne, der indische Unberührbare ebenso wie der koreanische Anti-Bush-Demonstrant, darauf geachtet, dem Nächsten nicht in den Weg zu treten.
Das Forum war also auch eine Schule der Höflichkeit. Eine diplomatische Veranstaltung, die Resolutionen erarbeitet oder Aktionsprogramme festlegt, war es freilich nicht. Und es war auch nicht für Beobachter gedacht, die das Gutmenschentum souverän verachten und für Eindrücke unempfindlich sind.
Der Rekord des George Bush
Wer traf sich in Bombay? Die Anliegen und Interessen der Besucher waren zu verschieden, als dass man sie „links“ nennen könnte. „Jesuits in Social Action“ versteht sich sicherlich nicht als linke Gruppierung. Wer gegen die Militärstützpunkte der Vereinigen Staaten opponiert, ist nicht notwendigerweise links. George W. Bush ist in der Tat verrufen, aber das nicht nur auf dem Weltsozialforum, sondern in ganz Indien. „Der Mann hat einen Rekord erzielt“, lautet das Urteil des Universitätsdozenten und Journalisten Subhoranjan Dasgupta, „noch nie hat ein amerikanischer Präsident es geschafft, sich so schnell so unbeliebt zu machen.“ So übel sei der Leumund des Präsidenten Bush, dass seine wenigen indischen Anhänger es nicht wagten, sich offen zu ihm zu bekennen.
Ein Anliegen gibt es, das alle Besucher des Forums einigt: Das ist das Bedürfnis, denen, die keine Rechte haben, wenigstens eine Stimme zu geben. Ein indisches Flugblatt, das auf dem WSF verteilt wurde, zitiert einen Kommentar der New York Times: Es gebe nur noch zwei Supermächte, „die Vereinigten Staaten und die globale Zivilgesellschaft“. Eine „Supermacht“, die kaum Einfluss hat, muss sich selbst gelegentlich erleben. Dem diente das Weltsozialforum.
Die Berliner Rosa-Luxemburg-Stiftung hatte Frauen aus Kriegsländern an einen Tisch gebeten. Eine Vertreterin der afghanischen Frauenorganisation „Rawa“ brachte eine ernüchternde Botschaft: „Nichts hat sich für die afghanischen Frauen geändert“, sagte Saher Saba, „Mädchen haben noch immer nicht die Möglichkeit, zur Schule zu gehen.“ Und ungeachtet ihrer Abgeordneten in der Loja Dschirga müsse „Rawa“ weiterhin im Untergrund arbeiten. „Wir versuchen, mit den liberaleren Kräften ins Gespräch zu kommen“, sagte die Frau.
Keine Gespräche gibt es zwischen den kolumbianischen Gewerkschaften und ihren Gegnern: 4000 Gewerkschafter seien in den vergangenen Jahren ermordet worden, berichtete Javier Correa, 3000 säßen im Gefängnis. Der Gewerkschafter, der ein ähnliches Schicksal gewärtigen muss, befürchtet, dass Kolumbiens Industriearbeiter eines Tages nicht einmal mehr Anstellungsverträge erhalten.
Correa arbeitet bei Coca Cola. Diese Angabe machte er mit einem kleinen Lächeln: Er wusste, dass der Konzern in Indien verschrieen ist. 1998 errichtete Coca Cola eine Abfüllanlage im regenarmen Plachimada im Bundesstaat Kerala. Die Fabrik schöpft das Grundwasser ab. Seither ernähren die Ernten die Menschen nicht mehr, die Frauen müssen kilometerweit um Trinkwasser laufen. Als dann auch noch bekannt wurde, dass Coca Cola den anfallenden verseuchten Klärschlamm als Dünger an die verarmten Bauern verkaufte, war das Maß voll.
(Franziska Augstein, Süddeutsche Zeitung)