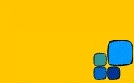Berichte
Globalisierung vor und nach dem 11. September
(von Gerhard Dilger, Informationsstelle Lateinamerika)
Porto Alegre - Vor dem Weltsozialforum mahnt der brasilianische Vordenker José Luís Fiori eine Phase der "stärkeren Reflexion" an. Ziel der GlobalisierungskritikerInnen müsse es sein, "Macht zu erobern und zu verändern"
ila: Herr Fiori, was heißt Globalisierung für Sie?
José Luís Fiori: Der US-Ökonom J. K. Galbraith hat 1997 gesagt: "Wir Amerikaner haben dieses Konzept erfunden, um unsere Politik der wirtschaftlichen Durchdringung anderer Länder zu verschleiern." Genauer könnte man sagen, es sind Veränderungen, die in den Siebzigerjahren begannen und sich in den Neunzigerjahren beschleunigten: vor allem der Zusammenschluss der nationalen Kapitalmärkte und die Bekräftigung der nordamerikanischen imperialen Macht. Die Globalisierung ist nicht ein rein ökonomisches Phänomen und schon gar nicht ein technologischer Zwang. Sie hat auch nicht die Macht der Nationalstaaten aufgehoben, die immer schon durch ihre gegenseitigen Rivalitäten begrenzt war. Auch die jüngsten Veränderungen haben nicht die langfristigen, seit 500 Jahren bestehenden Gesetzmäßigkeiten des kapitalistischen Systems außer Kraft gesetzt.
Nehmen wir das Beispiel Brasilien. Was haben die neoliberalen Neunzigerjahre dem Land gebracht?
Wie die Achtzigerjahre waren sie ein "verlorenes Jahrzehnt". Denn obwohl im Gegesatz zu vorher internationales Kapital verfügbar war, wuchs die Wirtschaft nicht schneller. In Brasilien herrschen heute dieselbe Armut und soziale Ausgrenzung wie am Ende der Militärdiktatur. Im neoliberalen Jahrzehnt haben unsere Regierungen den brasilianischen Staat demontiert, der heute nicht mehr fähig ist, strategische Aktionen jenseits der Währungspolitik zu planen. Die Bevölkerung, vor allem die Jugend, ist völlig von der Demokratie enttäuscht.
Doch im Zusammenhang mit der Krise in Argentinien wird der Wirtschaftskurs von Präsident Fernando Henrique Cardoso oft als weniger radikale Variante gelobt, die "funktioniert" habe...
Brasilien wurde nicht unmittelbar in Mitleidenschaft gezogen, weil die Infektion schon vorher passiert war. 2001 äußerte sie sich in einer gewaltigen Verlangsamung des Wirtschaftswachstums. Aber wahrscheinlich gibt es mittelfristig Auswirkungen auf die Handelsbilanz, die Kapitalreserven und das Zinsniveau, das hoch bleiben und so die Rezession verlängern wird. Vor ein, zwei Jahren hat der "Economist" geschrieben, Cardoso habe in fünf Jahren mehr liberale Reformen durchgesetzt als Frau Thatcher in einem Jahrzehnt.
Haben Sie eine Vorstellung davon, wie es in Argentinien weitergehen könnte?
Bisher scheint Washington eine orthodoxe Lösung nach den Regeln des Marktes zu favorisieren: Die argentinische Regierung wird die unvermeidlichen sozialen Folgen der wirtschaftlichen Katastrophe kontrollieren müssen. Es könnte zu einer "Russifizierung" Argentiniens kommen: Soziale und politische Auflösungserscheinungen, Streit zwischen mafiösen Machtgruppen, die gleichermaßen unfähig sind, den Staat wiederaufzubauen, der im Namen der neoliberalen Euphorie und der Globalisierungsillusion zerstört und versteigert wurde. Vorher wird wahrscheinlich eine Art Schuldentribunal eingerichtet, wie Anne Krueger vom Internationalen Währungsfonds angeregt hat: Die Kontrolle über die Steuern und Finanzen geht auf die Gläubiger über. Im Gegenzug bekommt das Land die Hilfe, die es bis zum Ende des Abwertungsprozesses braucht.
Was hat sich seit dem 11. September in der Weltpolitik verändert?
Probleme, die seit 1991 ungelöst sind, haben sich beschleunigt und zugespitzt. Nach dem Ende des Kalten Krieges war viel von "sanfter Revolution", "Ende der Geschichte" o. ä. die Rede. Es kam zu keinem Abkommen zwischen den wichtigen Mächten wie in Versailles oder Jalta, sondern zu einer enormen Machtverschiebung zugunsten der USA. Clintons Außenpolitik war von einem Wirtschaftsboom begleitet. Er nahm sich vor, die globale Hegemonie auf einem harmonischen Zusammenleben zwischen den wichtigsten Staaten und internationalen Akteuren aufzubauen. Dann kam Bush junior, der sich an der Idee eines US-Nationalinteresses orientieren wollte, das allerdings nach dem Ende der bipolaren Weltordnung schwer zu definieren war. Gleichzeitig ging der Wirtschaftsboom zu Ende.
Vor diesem Hintergrund fanden die Attentate vom 11. September statt, und deswegen sind auch die Auswirkungen so enorm. Jetzt finden Abrechnungen und Neupositionierungen statt. Im Schatten eines breiten Konsenses gegen den Terrorismus suchen zweitrangige Großmächte ihren neuen Platz auf dem internationalen Schachbrett, etwa Japan, Russland und Deutschland. Es ist, als würden sie ihre geopolitische Agenda aus den Zeiten vor dem Ersten Weltkrieg wiederaufnehmen. Außerdem rückt die große "eurasische Masse" wieder ins Epizentrum der Weltpolitik.
Wie beurteilen Sie das neue deutsche Selbstbewusstsein, das sich auch militärisch zu äußern beginnt?
Nach den raschen Transformation der letzen zehn Jahre, die ja von äußeren Veränderungen angestoßen wurden, fand sich Deutschland an der Spitze des europäischen Einigungsprozesses wieder und musste zudem mit der sehr komplexen historischen Grenze nach Osteuropa, speziell zu Russland, zurechtkommen. Wahrscheinlich wird sich Deutschland ähnlich behutsam wie Bismarck nach der Staatsgründung bewegen, aber das wird nur die Vorbereitungszeit sein, bis es wieder einen entscheidenden Platz innerhalb des Großen Spiels der Weltpoltik einnimmt.
Ist Bin Laden das große Feindbild, das sich die USA nach dem Ende des Kommunismus gewünscht hatten?
Ja, es gibt eine neue Art von Bipolarität. Daraus entstand die so genannte Bush-Doktrin, eine neue Strategie zur Kontrolle des Feindes, doch mit einem entscheidenden Unterschied und unabsehbaren Folgen: Der neue Feind ist unsichtbar und global, und während der langen Perioden seiner Unsichtbarkeit werden seine Absichten, seine Lokalisierung und seine Strategien von den USA definiert. Eine seltsame Bipolarität, bei der beide Kommandozentralen quasi den USA gehören. Außerdem soll ja die Kontrolle des unsichtbaren Feindes umfassend und jahrzehntelang dauern, wie der US-Vizepräsident Dick Cheney angekündigt hat. Es entsteht also gerade ein unsichtbares globales Kontroll- und Repressionsnetz, das Hannah Arendt Schauer über den Rücken jagen würde.
Bedeutet diese neue Aufwertung staatlicher Aufgaben nun das Ende des Neoliberalismus?
Nein, das Projekt der Universalisierung der "selbstregulierten" Märkte geht weiter. Seit Hiroshima und Nagasaki haben die USA in Krisenzeiten immer deutlich gemacht, dass die Märkte und die globalen Finanzen nur möglich sind, weil es die politische Macht des "Prinzen" gibt, der der Welt seine Macht und seine Währung aufzwingen kann. Das war 1973 so, als die USA die Dollar-Gold-Bindung auflösten und ein neues internationales Währungssystem einführten. Die exemplarische Zerstörung des Taliban-Regimes hat zwar den Staat und die Waffen wieder in den Mittelpunkt des Weltsystems gerückt, doch das neoliberale Globalisierungsprojekt besteht nach wie vor. Wie die Physiokraten, die französischen Liberalen des 18. Jahrhunderts, zu sagen pflegten: Der "perfekte Markt" setzt die Existenz eines "perfekten Tyrannen" voraus.
Durch die Ereignisse seit dem 11. September sind die globalisierungskritischen Kräfte in die Defensive geraten. Welche Konsequenzen sind daraus zu ziehen?
Ich denke, das Agieren der Großmächte nach außen und im Inneren macht auf Seiten der Globalisierungskritiker eine sorgfältigere Reflexion notwendig. Viele Linke meinten, die ökonomische Globalisierung und die neuen Kommunikationstechnologien hätten die nationalen Grenzen und Kämpfe verwischt. Die Euphorischsten träumten schon von einer "kosmopolitischen Demokratie". So wichtig die Demonstrationen in den Städten der "globalen Treffen" waren: Es wäre übertrieben, sie wichtiger zu nehmen als die Kämpfe der sozialen Bewegungen auf nationaler Ebene.
Welche Funktion kann das zweite Weltsozialforum in Porto Alegre dabei spielen?
Das ist ein Riesentreffen von Politikern, sozialen Bewegungen, Parteien, Gewerkschaften, Ethnien, Minderheiten, NGOs, die unterschiedlichste Vorschläge oder Projekte vertreten und Fragen aufwerfen. Ihr kleinster gemeinsamer Nenner ist das Gefühl, dass die Lage in den Jahren der boomenden Finanzglobalisierung und der US-Vorherrschaft nicht besser geworden ist. In den Neunzigerjahren gab es nur wenige dissonante Stimmen.
In Porto Alegre versammeln sich Hunderte von sozialen Organisationen mit ganz klarer, affirmativer Programmatik. Allerdings sind diese sehr heterogen. Durchsetzen lassen sich deren Forderungen aber nur in der Politik, dort, wo Macht erobert und verändert werden kann. Kein größeres politisches Projekt wird ohne Machtzentrum wirksam, und diese Machtzentren sind nach wie vor territorial und national organisiert. Mit dieser Schwierigkeit haben systemkritische internationalistische Bewegungen seit jeher zu kämpfen.
Nehmen wir das Beispiel der geplanten Amerika-Freihandelszone FTAA, die nach dem Willen Washingtons bis 2005 ausgehandelt sein soll. Selbst viele brasilianische Unternehmer sind skeptisch, und das "Volk von Porto Alegre" ist vehement dagegen. Welche Chancen hat dieser Widerstand?
Die FTAA ist ein ehrgeiziges Projekt: Gleichzeitig sollen Handelsbarrieren fallen, Respezialisierungen stattfinden und den USA die Entscheidungsgewalt bei jenen Streitfällen zugeschanzt werden, die ihre Firmen und ihr Kapital betreffen. Derzeit haben Argentinien und Brasilien zusammen die größte Auslandsverschuldung der Welt. Das schwächt sie bei den Verhandlungen. Doch da Mexiko bereits über die Freihandelszone NAFTA nach Nordamerika integriert ist, gibt es keine weiteren Länder von größerem Gewicht. Wenn die USA bei der Schaffung der FTAA genauso trickreich vorgehen, wie sie auf der ganzen Welt ihre Interessen verteidigen, sehe ich nur geringe Chancen für einen erfolgreichen Widerstand. Wenn überhaupt, dann nur, wenn Brasilien und Argentinien an einem Strang ziehen.
Wie soll das gehen? Schließlich ist ja in bei den brasilianischen Präsidentschaftswahlen 2002 ein Wahlsieg des linken Dauerkandidaten Lula eher unwahrscheinlich...
Er ist schwierig, aber nicht unmöglich. In diesem Fall müsste Lula eine progressive Regierungskoalition schmieden, die in der Lage ist, die strategischen Ziele der kapitalistischen Entwicklung Brasiliens zu verändern. Sie müsste den konservativen Pakt aufbrechen, der dieses Land seit Jahrzehnten dominiert, und die eine positive Neubewertung von Nation und föderativer Solidarität bewerkstelligen. Obwohl all das schwierig ist, nin ich recht zuversichtlich, denn die Geschichte lehrt uns, dass sich nur in den Stunden der großen weltweiten Veränderungen neue Chancen für die Peripherie eröffnen.
(José Luís Fiori, 56, ist Professor für internationale politische Ökonomie an der Bundesuniversität Rio de Janeiro (UFRJ) und einer der führenden brasilianischen Intellektuellen. Er schreibt gerade an einem Buch über das "amerikanische Imperium" und tritt erneut als Referent beim Weltsozialforum in Porto Alegre auf.)